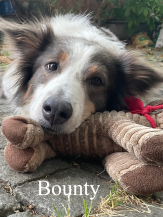Aktuelles
Ist mein Tier gesund?
Ein Check-up für Zuhause

Damit es Hund und Katze auch lange gut geht, muss der Tierbesitzer immer mit einem aufmerksamen Auge darauf achten, ob sich eventuelle Abweichungen im Aussehen oder Verhalten seines Tieres zeigen. Werden nämlich bestimmte Krankheiten früh erkannt, können sie viel erfolgversprechender behandelt werden. Man sollte sich bewusst sein, dass bei Tieren Krankheitsverläufe sehr viel schneller in ein ernstzunehmendes, unter Umständen sogar lebensbedrohliches Stadium übergehen können, als wir es bei uns Menschen gewohnt sind. Dies gilt vor allem für Jungtiere.
Die wichtigsten Regeln
Schon am Allgemeinzustand eines Tieres kann man in der Regel sehen, ob es gesund ist oder nicht. Ist es matt, wirkt es apathisch und hat wenig Appetit, steckt meist eine Erkrankung dahinter. Erbrechen, Durchfall oder Verstopfung und Schwierigkeiten beim Harnabsatz sind Anzeichen für Erkrankungen des Verdauungsapparates, für Vergiftungen oder Nieren-Blasen-Leiden. Auf Augen, Ohren und Nase des Tieres muss man ebenfalls achten. Sind diese verklebt oder sogar vereitert, liegt sicherlich eine Entzündung vor. Auch die Zähne sollten regelmäßig kontrolliert werden. Ein anderes Erkennungsmerkmal für eventuell vorliegende Krankheiten ist das Fell. Ist es struppig und stumpf statt glatt und glänzend (natürlich mit rassebedingten Unterschieden), sollte man das Tier genauer beobachten und zum Tierarzt bringen, denn es könnten innere Erkrankungen oder aber Parasitenbefall vorliegen. Der Tierbesitzer sollte ab und zu auch einmal den gesamten Körper seines Tieres abtasten, um Umfangsvermehrungen (z. B. Tumoren) rechtzeitig zu erkennen.
Der Rat
Haben Sie immer ein offenes Auge für eventuelle Veränderungen des Verhaltens oder des Körpers Ihres Tieres. Sie müssen nicht wegen jeder Kleinigkeit besorgt sein. Wenn
Sie jedoch den Verdacht haben, dass Ihr Tier krank ist, sollten Sie auf jeden Fall den Tierarzt aufsuchen.
Wenn Ihr Tier plötzlich ernsthaft erkrankt (z. B. hochgradige Schmerzen, Krampfanfall) oder eine schwere Verletzung erlitten hat, sollten Sie zuerst den Tierarzt anrufen und ihm den Zustand des
Tieres genau schildern. Er kann aus Ihren Beobachtungen meist schon Schlüsse auf die Art der Erkrankung ziehen und Ihnen sagen, wie Sie sich am besten verhalten. Wichtig ist das beispielsweise bei
Bandscheibenverletzungen, wie sie häufig bei Hunden kleiner Rassen vorkommen. Steht ein Dackel plötzlich steif da und wird aggressiv oder schreit laut auf, wenn sein Besitzer ihn anfassen will, liegt
das mit großer Wahrscheinlichkeit an einem Bandscheibenvorfall. Der Tierarzt wird dem Besitzer in einem solchen Fall genaue Anweisungen geben, denn in einer derartigen Situation ist vorsichtiges
Handeln geboten, damit durch eine falsche Behandlung keine völlige Querschnittslähmung entsteht.
Checkliste
| Region | Merkmale des gesunden Tieres | Merkmale des kranken Tieres |
|---|---|---|
| Allgemeinzustand | Das Tier verhält sich unauffällig, ist munter und ausgeglichen und hat einen guten Appetit. | Das Tier ist matt und unlustig. Es liegt oder schläft viel oder wird plötzlich aggressiv. Es frisst schlecht, verweigert sogar kleine Leckerbissen und/oder trinkt auffällig viel. |
| Augen | Die Augen sind klar und tränen nicht. Die Lidbindehäute sind rosa. |
Die Augen sind trüb, verklebt, tränen oder eitern sogar. Die Bindehäute sind gerötet, weiß oder gelb gefärbt.
|
|
Ohren
|
Die Ohrmuscheln sind sauber. |
Die Ohrmuscheln sind gerötet, verkrustet und/oder mit übermäßig viel Ohrenschmalz, übelriechendem Sekret oder Eiter bedeckt. Das Tier schüttelt häufig den Kopf und kratzt sich an den Ohren.
|
| Nase | Die Nase ist sauber. |
Die Nase ist verklebt oder sogar vereitert und fühlt sich sehr heiß und trocken an.
|
| Maul |
Zahnfleisch und Mundschleimhaut sind rosa gefärbt, die Zähne weiß und frei von Belägen. |
Das Zahnfleisch ist gerötet und wund, die Mundschleimhaut blass oder gelb gefärbt. Das Tier speichelt und riecht aus dem Maul. Die Zähne weisen starke Beläge bzw. Zahnstein auf. |
| Fell |
Das Fell glänzt und liegt regelmäßig am Körper. (Rassetypische Unterschiede sind zu beachten.) |
Das Fell ist stumpf und struppig. Das Tier hat vermehrten Haarausfall. |
| Haut | Die Haut ist glatt und nicht schuppig oder gerötet. |
Die Haut ist gerötet, aufgekratzt, verkrustet oder sogar vereitert. Das Tier schleckt, kratzt oder beißt an bestimmten Körperregionen.
|
| Gliedmaßen |
Das Tier hat weder beim Laufen und Springen noch beim Aufstehen und Hinlegen Probleme.
|
Das Tier lahmt, läuft oder springt nicht mehr gerne, weigert sich plötzlich, Treppen zu steigen und hat Schwierigkeiten beim Aufstehen und Hinlegen. |
| Rücken |
Das Tier steht und läuft normal und zeigt keine steife Körperhaltung oder verkrampfte Bewegungen.
|
Das Tier steht mit gekrümmtem Rücken und hat einen staksigen Gang. |
| Körperteile allgemein |
Das Tier weist keine anormalen Merkmale an Gliedmaßen und Körper auf. |
Das Tier hat Schwellungen, das Berühren bestimmter Körperteile bereitet ihm Schmerzen. |
| Verdauungsorgane | Das Tier hat eine geregelte Verdauung und zeigt keine Anzeichen von Schmerz im Bauchbereich. |
Das Tier würgt, erbricht, hat Durchfall oder Blähungen. Es hat Schwierigkeiten beim Kotabsatz und/oder setzt weniger häufig Kot ab. Die Afterregion ist verklebt oder verschmutzt. Der Hund rutscht häufig mit dem Hinterteil über den Boden (sog. „Schlittenfahren”).
|
| Harnorgane | Das Tier hat keine Probleme beim Harnabsatz. Der Harn ist normal gefärbt. |
Das Tier hat Schwierigkeiten beim Harnlassen. Der Urin wird immer wieder in kleinen Mengen oder aber in sehr großen Mengen abgesetzt. Der Urin ist blutig.
|
| Atmungsorgane | Das Tier atmet in Ruhe ruhig und gleichmäßig. Es hustet oder niest nicht. | Das Tier hustet und/oder niest oft. Die Atmung ist beschleunigt, ohne dass das Tier getobt hat. Es atmet schon nach leichter Anstrengung schwer oder zeigt Maulatmung. |
| Herz-/Kreislaufsystem | Das Tier ist (altersabhängig) bewegungsfreudig und wird nicht auffällig schnell müde. | Das Tier bewegt sich ungern, hustet häufig oder zeigt eine bläuliche Verfärbung der Zunge. Das Tier hat gelegentlich Ohnmachten oder Krampfanfälle. |
| Nervensystem | Das Tier verhält sich unauffällig. | Das Tier zeigt einen schwankenden, torkelnden Gang, Krampfanfälle oder wird plötzlich aggressiv. |
Kontrolle

Maulhöhle
Die regelmäßige Kontrolle der Maulhöhle ist wichtig, um Zahnbeläge bzw. Zahnstein, faule Zähne oder Entzündungen des Zahnfleisches frühzeitig feststellen zu können.

Augen
Leichte Verkrustungen in den Augenwinkeln können mit einem angefeuchteten Papiertaschentusch entfernt werden. Gerötete Bindehäute mit gelbem Ausfluss deuten auf eine Entzündung hin, die tierärztlich behandelt werden muss.

Ohren
Auch die Ohrmuscheln müssen regelmäßig auf Verkrustungen oder übermäßige Sekretbildung kontrolliert werden. Leicht verschmutzte Ohrmuscheln können vorsichtig mit einem feuchten Papiertaschentuch gereinigt werden.

After
Eine verschmutzte Afterregion deutet auf Durchfall hin, der – wenn er andauert – tierärztlich behandelt werden muss. Verklebungen werden mit einem feuchten Tuch gesäubert.
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V.
Zecken gefährden die Gesundheit Ihres Tieres

Zecken saugen Blut, nur dann können sie Eier legen und sich vermehren. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die sich nach erneuter Blutmahl-zeit zu winzigen
„Nymphen“ entwickeln. Auch diese saugen Blut und häuten sich schließlich zu erwachsenen Zecken. Bei jeder Blutmahlzeit gelangt der Speichel dieser Spinnentiere in die Stichwun-de. Der Zeckenstich
selbst verursacht bei Hunden und Katzen meist heftigen Juckreiz und/oder Schwellungen. Sind jedoch Krankheitserreger im Zeckenspeichel enthalten, können mit einem Stich zum Teil lebensgefährliche
Krankheiten wie Anaplasmose, Babesiose, Borreliose, Ehrlichiose oder in sehr seltenen Fällen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) auf Hunde übertragen werden. Unbehandelt verlaufen diese Krankheiten
oft akut oder sogar tödlich.
Hochsaison haben die kleinen Blutsauger gewöhnlich von März bis Ende Oktober, je nach Wetterlage auch bis November. Aktuelle Studien weisen jedoch darauf hin, dass Zecken, die Krankheitserreger in
sich tragen, Kälte und Hitze besser überleben als Zecken, die nicht infiziert sind. So zeigte sich zum Beispiel, dass der „Gemeine Holzbock“ (Ixodes ricinus), wenn er den Erreger der Anaplasmose in
sich trägt, bei winterlichen Temperaturen ein Antifrost-Schutzenzym bildet, das seine Überlebensrate im Vergleich zu nicht infizierten Zecken erhöht. Außerdem wurde festgestellt, dass mit dem
Borreliose-Erreger befallene Zecken weniger empfindlich auf Wärme und Trockenheit reagieren und zu einem deutlich höheren Anteil überleben als andere Zecken. Folglich ist davon auszugehen, dass in
sehr kalten wie auch in sehr warmen und trockenen Monaten der Anteil der Krankheitserreger tragenden Zecken höher sein kann, als bislang gedacht.
Vorbeugung
Gegen die Borreliose werden für Hunde verschiedene Impfstoffe angeboten, die allerdings nur gegen drei Borrelienarten schützen. Ebenso steht gegen die Babesiose ein
Impfstoff zur Verfügung. Dieser ist zwar in Deutschland zurzeit nicht erhältlich, kann aber vom Tierarzt mit einer Ausnahmegenehmigung aus dem europäischen Ausland bezogen werden. Der Impfstoff
schützt jedoch nicht vor einer Infektion, sondern mildert lediglich den Krankheitsverlauf. Gegen die anderen von Zecken übertragenen Krankheiten gibt es keine Impfung.
Mit vorbeugenden Maßnahmen kann man Borreliose und Co. aber dennoch erfolgreich den Kampf ansagen. Dazu gehören: Schnelles Entfernen der Zecken und Verwendung von Parasiten abtötenden Präparaten. Je
nach Zeckenart und Erreger sind die Übertragungszeiten unterschiedlich. Borrelien werden 6 bis 72 Stunden nach dem Zeckenstich übertragen, die Erreger der Anaplasmose innerhalb von 24 Stunden, die
der FSME nach nur wenigen Minuten und Babesien nach 48 Stunden. Männliche Auwaldzecken, die bereits einmal Blut gesaugt haben, können allerdings Babesioseserreger sofort nach dem Einstich
übertragen.
Hunde sollte man deshalb auf jeden Fall nach jedem Spaziergang nach Zecken absuchen. Katzen erkranken zwar nicht an Borreliose, sollten aber zur Verhinderung der lokalen Symptome mindestens einmal
täglich kontrolliert werden. Bevorzugte „Andock-Stellen“ sind die gefäßreichen, dünnhäutigen Partien an Kopf, Hals, Schultern und Achseln. Wichtig: Mit einer speziellen Zeckenzange oder einem –haken
lassen sich die Zecken fassen und unter sanftem Zug aus der Haut ziehen. Keinesfalls sollte man sie zuvor mit Öl oder anderen Flüssigkeiten versuchen abzutöten, denn gerade im Todeskampf bringen
Zecken ihren möglicherweise infektiösen Speichel vermehrt in die Wunde ein.
Doch durch alleiniges Absuchen des Tieres wird keine Sicherheit erreicht, denn zu viele Zecken werden bei dieser Methode selbst von Fachleuten übersehen. Oft kann man die sie erst Tage nach Beginn
der Blutmahlzeit, wenn sie sich mit Blut voll gesaugt und den Hund bereits infiziert haben, erkennen und entfernen. Um die Tiere vor ungebetenem Besuch zu schützen oder den kleinen Biestern den
Appetit zu verleiden, stehen Spot-on-Präparate, Sprays oder antiparasitäre Halsbänder in den Tierarztpraxen zur Verfügung.
Die Spot-on-Präparate vom Tierarzt schützen wie mit einem unsichtbaren Schutzschild, zum einen durch ihre abschreckende Wirkung (Repellenteffekt), zum anderen durch ihre abtötende Wirkung. Sie werden
direkt auf die Haut im Nacken der Hunde (bei großen Hunden zusätzlich auf die Haut im Bereich der Kruppe) geträufelt. Vorsicht, einige Präparate sind hochgiftig für Katzen oder auch Hauskaninchen!
Der Wirkstoff verteilt sich innerhalb eines Tages über den ganzen Körper und lagert sich in die oberste Hautschicht ein. Die Behandlung muss, ebenso wie das Einsprühen, in Abständen nach den Vorgaben
des Herstellers wiederholt werden. Der in den Halsbändern enthaltene, Zecken abtötende Wirkstoff wird kontinuierlich abgegeben. Er verteilt sich ebenfalls über den gesamten Tierkörper und lagert sich
in die oberste Hautschicht ein. Gelegentliches Schwimmen, oder Regen vermindern die Wirkung nicht. In Teichen mit Fischbesatz sollten Hunde, die antiparasitäre Halsbänder tragen, jedoch nicht baden,
da einige Wirkstoffe für Fische giftig sind.
Auch der Zoo- und Versandhandel bietet eine Vielzahl von teils fragwürdigen Produkten an. So verhindern beispielsweise Bierhefe oder Sprays, die mit Molke angeblich die Atemöffnungen der Zecken
verkleben sollen, den Befall mit den Parasiten nicht. Auch die Wirksamkeit von so genannten „biomagnetisierten“ Metallplaketten konnte bisher nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden. Sie beruht
allein auf der subjektiven Wahrnehmung der Besitzer.
Darüber hinaus rät ein altes Hausrezept zu Knoblauch, doch ist weder die Wirkung belegt, noch ist es ratsam, Knoblauch bei Hund und Katze einzusetzen, denn wie alle Zwiebelgewächse ist auch der dazu zählende Knoblauch für beide Tierarten giftig!
Besonders wichtig: Nicht alle Zeckenmittel sind für jede Tierart in jedem Lebensalter gefahrlos geeignet. Welches Produkt für Ihren Hund oder Ihre Katze in Frage kommt, erfahren Sie am besten in Ihrer Tierarztpraxis. Dort werden Sie ausführlich beraten und auf mögliche Nebenwirkungen oder Giftpotentiale hingewiesen.
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V.
Übergewicht - kein Schönheitsfehler

Bis zu 50 Prozent aller Hunde sind übergewichtig oder sogar fettleibig. Zu viel Speck auf den Rippen zu haben ist aber nicht nur eine optische Angelegenheit. Es ist
ein erheblicher Risikofaktor für Krankheiten wie Diabetes, Herz-/Kreislauf- und Gelenkerkrankungen, die die Lebenserwartung eines Tieres um bis zu 2 Jahre verkürzen können.
Außerdem vertragen „Dickerchen“ weniger Hitze, sind reizbarer und nicht so beweglich wie ihre normalgewichtigen Artgenossen. Häufig ist auch ihr Immunsystem geschwächt.
Wie entsteht Übergewicht?
Bei vielen Hunden wird der Grundstein zum Übergewicht schon im Welpenalter gelegt. Durch eine zu reichhaltige Fütterung werden mehr Fettzellen als bei normal ernährten Welpen gebildet. Die Anzahl der Fettzellen ändert sich später nicht mehr, sodass im Erwachsenenalter ein höheres Übergewichtsrisiko besteht. Dauerhaft zu viel zugeführte Kalorien, führen letztlich zur Fettsucht (Adipositas). Als fett wird ein Tier erachtet, wenn sein Körpergewicht 20 Prozent über dem Idealgewicht seiner Rasse liegt. Das Risiko für Fettsucht nimmt im Alter zwischen 6 und 12 Jahren deutlich zu.
Neben dem Zuviel an Futter wird das stetige Zunehmen durch Bewegungsmangel begünstigt. Hinzu kommt, dass mit zunehmendem Gewicht die Bewegungsfreude nachlässt, sodass ein Teufelskreis entsteht. Bei einigen Hunderassen (z. B. Cocker Spaniel, Labrador) spielt auch die Veranlagung zur Dickleibigkeit eine Rolle. Ebenso birgt die Kastration ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Übergewicht, denn der Einfluss der Geschlechtshormone, die Appetit und Stoffwechsel regulieren, fällt weg. Übermäßiger Appetit bei gleichzeitig vermindertem Energiebedarf ist häufig die Folge. In seltenen Fällen kann aber auch eine Erkrankung Ursache der Gewichtszunahme sein, wie eine Schilddrüsenunterfunktion. Umso wichtiger ist deshalb die tierärztliche Kontrolle, wenn ein Tier stetig zunimmt.
Anzeichen von Übergewicht
Ob Ihr Tier normalgewichtig ist oder schon zuviel Speck angesetzt hat, können Sie anhand der folgenden Merkmale schnell selbst beurteilen:

1. Ist der Schwanzansatz verdickt?
2. Ist die Taille schwer erkennbar?
3. Ist der Rücken breit?
4. Lassen sich die Rippen schwer ertasten?
Zu diesen äußeren Anzeichen kommen meist noch Verhaltensänderungen hinzu. So sind übergewichtige Tiere oft müde und nur schwer zum Spielen anzuregen. Dicke Hunde bleiben beim Spaziergang zurück, brauchen Hilfe beim Einsteigen ins Auto, stehen beim Bellen nicht mehr auf und hecheln ständig. Katzen zögern beim Springen auf Möbel, können sich nicht mehr richtig putzen und haben deshalb filziges Fell auf dem Rücken oder im Schwanzbereich.
Wenn Sie einige dieser Anzeichen bei Ihrem Tier feststellen, dann sollten Sie baldmöglichst tierärztlichen Rat einholen.
Diagnose Übergewicht
In der Tierarztpraxis wird Ihr Tier gewogen und genau untersucht, um auszuschließen, dass eine Erkrankung Ursache des Übergewichts ist. Ist dies geklärt, wird festgelegt, wie viel der Patient innerhalb welchen Zeitraumes abnehmen sollte. Hierfür wird ein individueller Ernährungsplan und ein Bewegungsprogramm erstellt. Ihre Bemühungen werden mit Sicherheit von Erfolg gekrönt sein, wenn
- Sie den Ernährungsplan strikt einhalten,
- Sie Ihrem Tier keine Essensreste vom Tisch geben und alle noch so traurigen Blicke und aufdringlichen Verhaltensweisen ignorieren,
- Sie Leckereien „nur mal so zwischendurch“ ab sofort vom Futterplan streichen,
- Sie für die Belohnung mit „Leckerlies“ einen Teil der Tagesration des zum Abspecken empfohlenen Futters nutzen,
- Sie mindestens eine Stunde täglich für das Bewegungsprogramm mit Ihrem Tier einplanen. Das gilt nicht nur für Hundebesitzer. Auch Katzen, insbesondere Wohnungskatzen, müssen zu mehr Aktivität angespornt werden (z. B. durch Werfen von Futterbröckchen).
Ist das angestrebte Gewicht erreicht, sollten Sie künftig durch eine verantwortungsvolle Fütterung und Haltung dafür sorgen, dass Ihr Tier „in Form“ bleibt“. Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag zu seiner Gesunderhaltung.
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V.
Foto: Schlagbauer/pixelio.de
Streit im Revier

Je mehr Katzen in einem Gebiet gehalten werden, desto häufiger kommt es zu Auseinandersetzungen. Biss- und Kratzverletzungen sind dabei keine seltene Folge. Stärkere Katzen, die sich einem Kampf stellen, tragen diese im Kopfbereich und an den Vorderbeinen davon. Die unterlegenen Tiere, die das Weite suchen, erwischt der Gegner eher im Bereich von Rücken, Hintergliedmaßen und Schwanz.
Ein Biss und seine Folgen
Ein Biss mit den langen spitzen Katzeneckzähnen ist einem Dolchstich vergleichbar und hinterlässt nur eine kleine Stichwunde. Sie blutet kaum und schließt sich schnell. Mit dem Biss gelangen jedoch Bakterien von der Hautoberfläche sowie vor allem aus der Maulhöhle der beißenden Katze in das Gewebe. Sie vermehren sich massiv und es kommt zur Entzündung und Eiterbildung. Zeigt eine Katze nach einem Ausflug Krankheitsanzeichen wie Teilnahmslosigkeit, Fressunlust, Abwehrverhalten und findet man beim Abtasten eine Vorwölbung, manchmal mit aufgestellten, verklebten Haaren, hat sich ein Abszess als Resultat einer Bissverletzung entwickelt. Der Abszess liegt meist unter der Haut, doch kann die Infektion auch auf tiefer liegende Gewebe wie Muskulatur übergreifen. Zusätzliche Komplikationen sind eine Beteiligung von Knochen und Gelenken sowie eine Blutvergiftung. Letztere kann bleibende Schäden an Organen wie Herz, Leber und Nieren hinterlassen und unbehandelt im Extremfall zum Tod der Katze führen. Auch beim Menschen kann ein Katzenbiss schwere Folgen haben!
Wird eine Bissverletzung frühzeitig erkannt, lässt sich die Abszessbildung durch eine sofortige tierärztliche Behandlung verhindern. Hat sich aber ein Abszess bereits gebildet, ist neben der antibiotischen Versorgung eine chirurgische Behandlung fast immer notwendig.
Bild: Behr/bpt
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V.